Über mich
Angebot
Kontakt
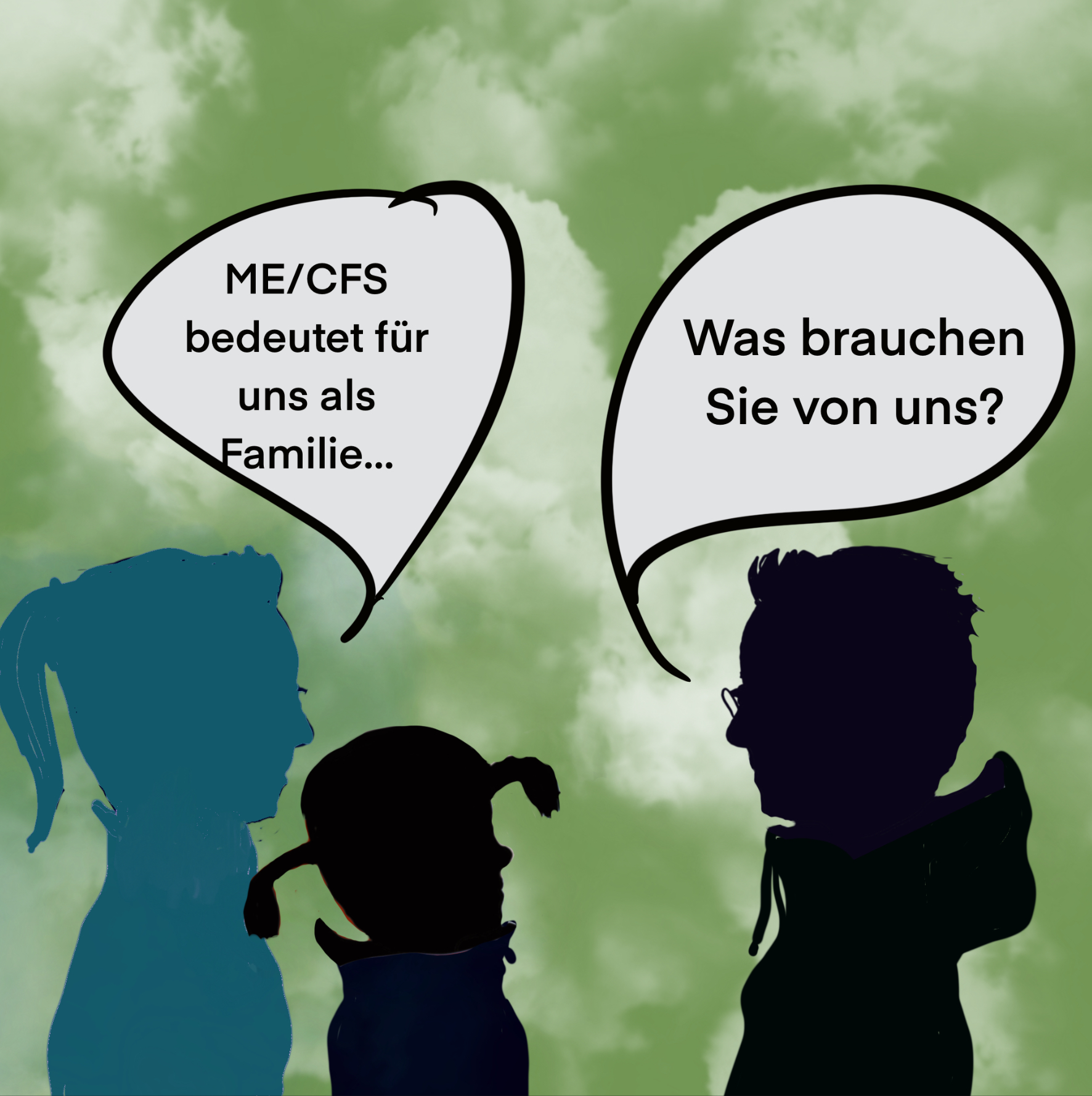
Myalgische Enzephalomyelitis / Chronisches Fatnes-Syndrom (ME/CFS) stellt bei Kindern und Jugendlichen eine besondere Herausforderung für das Versorgungssystem dar. Während die Erkrankung bei Erwachsenen zunehmend Beachtung findet, bleiben die spezifischen Bedürfnisse jüngerer Patienten bislang zu wenig beleuchtet. Fachkräfte aus Medizin, Psychologie, Schule, Sozialarbeit und Pflege stehen vor komplexen Fragen: Wie erkennen wir ME/CFS bei jungen Patienten? Wie unterscheiden wir es von anderen Erkrankungen? Und vor allem: Wie können wir Familien nachhaltig begleiten, obwohl kausale Therapieansätze bislang fehlen?
Die Leitlinienlage zur Diagnosestellung von ME/CFS orientiert sich international u.a. an den IOM/NAM-Kriterien (Institute of Medicine / National Academy of Medicine, 2015) und den Canadian Consensus Criteria (Carruthers et al., 2003). Beide definieren klare Leitsymptome wie:
Gerade bei Jugendlichen gestaltet sich die Diagnostik jedoch schwieriger als bei Erwachsenen:
Ergänzend berichten Fachstellen übereinstimmend, dass bislang nahezu ausschließlich Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern vorgestellt werden. Für die betroffenen Eltern entsteht häufig das sogenannte "Helikopter-Dilemma": Ohne massives Engagement können sie kaum angemessene Hilfen für ihr Kind durchsetzen; zugleich wird insbesondere mütterliches Engagement rasch psychologisiert und pathologisiert.
Deshalb empfiehlt sich für Fachkräfte ein differenziertes Vorgehen mit klarer Fokussierung auf Belastungsintoleranz, d.h. PEM als Leitsymptom.
Das Schulsystem wird für betroffene Familien häufig zum zentralen Konfliktfeld. Fachpersonen aus Schule, Schulverwaltung und Inklusion sollten sich bewusst sein:
Erkrankte Jugendliche stehen nicht isoliert im therapeutischen Raum. Vielmehr wirken familiäre, schulische und soziale Dynamiken ineinander:
Fachkräfte sollten eine begleitende Elternarbeit einplanen, die sowohl psychoedukative Elemente (Verständnis für PEM, Pacing, Akzeptanzprozesse) als auch systemische Entlastungsstrategien umfasst.
In der therapeutischen Begleitung betroffener Familien ist das Konzept des Pacings (kontinuierliche Anpassung aller Aktivitäten an die individuelle Belastbarkeit) zentral. Dabei gilt es, sowohl körperliche wie kognitive und emotionale Belastungen gleichermaßen zu berücksichtigen. Die Baseline – das individuell verträgliche Belastungsniveau – ist dynamisch und muss regelmäßig gemeinsam mit den Patienten erarbeitet und angepasst werden.
Fachpersonen können hier entscheidend zur Stabilisierung beitragen, indem sie:
Aufgrund der Komplexität der Erkrankung ist eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit essenziell:
Kommunikation zwischen diesen Akteuren erfordert für ME/CFS spezifische Schulung, um Fehlinterpretationen (z.B. psychiatrische Fehldiagnosen, "Elternfehlverhalten") vorzubeugen.
ME/CFS bei Jugendlichen fordert das interdisziplinäre Versorgungssystem auf besondere Weise heraus. Die Kombination aus neuroimmunologischen, kognitiven und psychosozialen Komponenten erfordert ein hochindividualisiertes Begleitkonzept, das Stabilisierung vor Belastungssteigerung stellt. Fachkräfte aller Disziplinen können durch fundiertes Wissen, geduldige Prozessbegleitung und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wesentlich zur Entlastung der betroffenen Familien beitragen.
In meiner Arbeit erlebe ich häufig, dass ich als Vermittlerin zwischen den verschiedenen Professionen wirksam werden kann. Als ehemalige Schulleiterin mit dem Schwerpunkt Inklusion und als selbst an ME/CFS erkrankte Fachperson kenne ich sowohl die inneren Logiken schulischer, behördlicher und medizinischer Strukturen als auch die individuellen Belastungen der betroffenen Familien. Diese doppelte Expertise erlaubt es mir, Brücken zwischen den Beteiligten zu bauen, Konflikte zu entschärfen und tragfähige Lösungen zu entwickeln.
Zu den hier dargestellten Themen biete ich aktuell folgende Veranstaltungen an:
Zu den beiden letzten Terminen können Sie sich per Mail bei mir anmelden. Kurz vor Beginn schicke ich dann den entsprechenden Zoomlink zu.