Über mich
Angebot
Kontakt
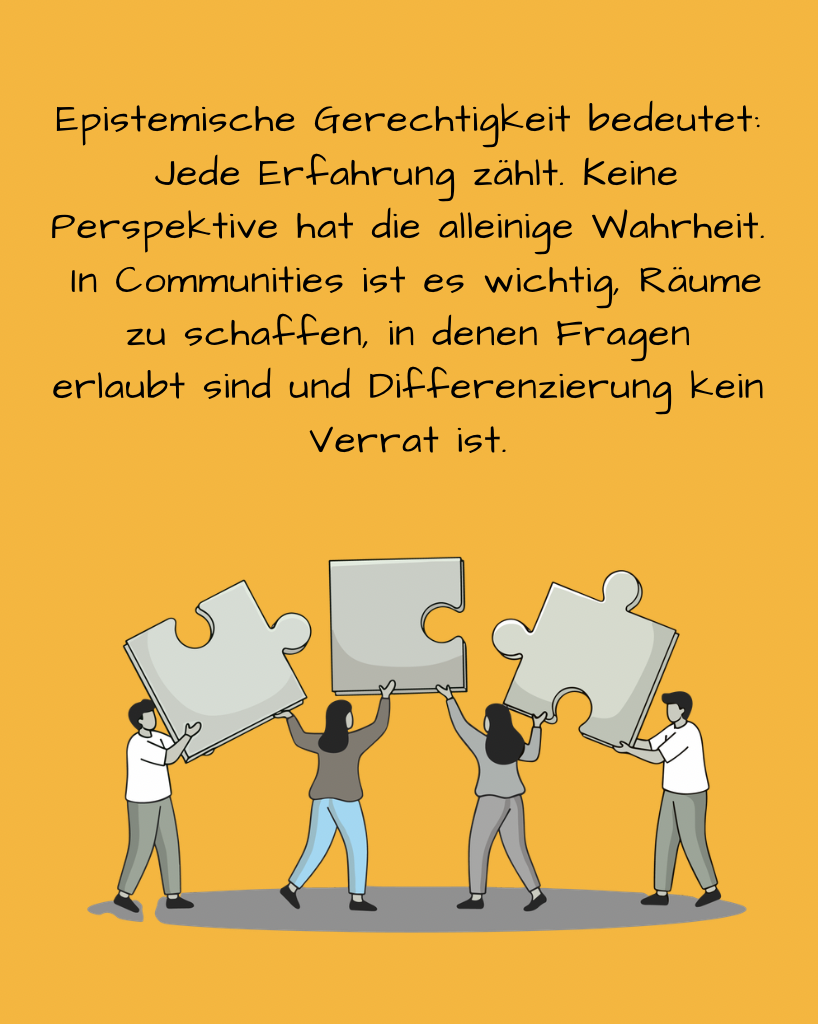
Warum geben ME/CFS-Communities so viel Halt und geraten gleichzeitig manchmal in Muster, die Betroffene unfrei machen?
Für viele Menschen mit ME/CFS ist Gemeinschaft kein Zusatzangebot, kein „Nice-to-have“, sondern eine existentielle Ressource. In einem Gesundheitssystem, das über Jahrzehnte versagt hat, sind Selbsthilfegruppen, Online-Communities und informelle Netzwerke zu zentralen Orten von Wissen, Orientierung und Überleben geworden. Hier wird geglaubt, wo andere zweifeln. Hier wird verstanden, wo außerhalb oft relativiert oder psychologisiert wird.
Gemeinschaft schützt. Und genau deshalb ist sie so wertvoll.
Doch Schutz ist nicht neutral. Wo Schutz entsteht, entsteht auch Macht. Und wo Macht nicht reflektiert wird, kann sie trotz bester Absichten zur Begrenzung werden.
Gemeinschaft als Überlebensstruktur
ME/CFS ist geprägt von struktureller Nichtanerkennung. Viele Betroffene erleben jahrelange Odysseen durch Arztpraxen, Gutachten, Behörden und soziale Kontexte, in denen ihre Symptome angezweifelt, bagatellisiert oder fehlgedeutet werden. Diese Erfahrungen sind nicht nur frustrierend, sie sind tief verletzend.
Vor diesem Hintergrund entstehen Communities als Gegenraum. Ein Raum, in dem Wissen nicht abgesprochen, sondern gesammelt wird. In dem Erfahrungen ernst genommen werden. In dem Menschen sich gegenseitig vor Fehlbehandlungen warnen, Informationen teilen, Halt geben.
Gerade weil die medizinische Versorgung oft unzureichend ist, wird Wissen in der Community zu einer lebenswichtigen Ressource. Symptome, Verläufe, Risiken, Trigger , vieles wird hier präziser benannt als im offiziellen System. Diese kollektive Wissensbildung ist eine Form von Selbstermächtigung.
Doch jede Form von Selbstermächtigung trägt auch die Frage in sich:
Wer definiert, was gilt?
Wenn Schutz beginnt, sich zu verhärten
Wo Gemeinschaft Sicherheit schafft, entsteht fast zwangsläufig ein Bedürfnis nach Klarheit. Nach Orientierung. Nach festen Linien in einem Feld, das von Unsicherheit, Angst und Kontrollverlust geprägt ist.
In vielen Selbsthilfegruppen entwickeln sich deshalb implizite Regeln:
So muss ME/CFS aussehen.
Diese Symptome sind typisch, andere eher verdächtig.
Diese Therapie ist gefährlich, diese unverantwortlich, diese alternativlos.
Diese Geschichte ist glaubwürdig, diese problematisch.
Diese Regeln entstehen nicht aus Machtmissbrauch. Sie entstehen aus Schutzlogik. Wer selbst verletzt wurde, möchte verhindern, dass andere den gleichen Schaden erleiden. Doch genau hier liegt die Spannung: Schutz kann kippen.
Wenn Sicherheit nur noch durch Vereinheitlichung möglich scheint, verliert Vielfalt ihren Platz. Abweichende Erfahrungen werden nicht mehr als Ergänzung, sondern als Risiko wahrgenommen. Fragen wirken wie Infragestellung. Differenzierung wie Relativierung.
Was als Schutzraum begonnen hat, kann unmerklich zu einem Raum werden, in dem nur bestimmte Narrative Platz haben.
Deutungshoheit und ihre leisen Nebenwirkungen
Deutungshoheit bedeutet nicht zwangsläufig offene Kontrolle. Sie wirkt oft subtil. Sie zeigt sich darin, welche Erfahrungen bestätigt werden und welche mit Schweigen, Skepsis oder moralischer Bewertung beantwortet werden.
Für Betroffene kann das tief verunsichernd sein. Wer ohnehin mit einer schwer planbaren Erkrankung lebt, braucht Räume, in denen Unsicherheit erlaubt ist. Wenn diese Unsicherheit jedoch mit impliziten Normen kollidiert, entsteht zusätzlicher innerer Druck.
Man passt sich an. Man verschweigt Teile der eigenen Erfahrung. Man vermeidet Fragen. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Angst, den Halt zu verlieren, den die Gemeinschaft bietet.
So entsteht ein paradoxer Effekt: Der Ort, der eigentlich entlasten soll, wird selbst zur Quelle von Spannung.
Epistemische Gerechtigkeit als notwendiger Gegenpol
Viele Menschen mit ME/CFS kennen epistemische Ungerechtigkeit aus erster Hand. Ihr Wissen wurde über Jahre entwertet, von Ärzt:innen, Gutachter:innen, Institutionen. Die eigene Erfahrung galt nicht als valide Erkenntnis.
In der Community entsteht daraufhin häufig eine Gegenbewegung:
„Nur wir wissen, wie es wirklich ist.“
Diese Haltung ist nachvollziehbar. Doch sie wird problematisch, wenn sie sich schließt. Wenn neue Perspektiven nicht geprüft, sondern vorsorglich abgewehrt werden. Wenn körpertherapeutische Ansätze, Traumawissen, Regulationsmodelle oder individuelle Unterschiede pauschal als Bedrohung gelten.
Epistemische Gerechtigkeit bedeutet nicht Beliebigkeit. Sie bedeutet, anzuerkennen, dass Wissen vielgestaltig ist. Dass Erfahrungen sich widersprechen dürfen. Dass keine einzelne Perspektive das Ganze erfassen kann.
Gerade eine Community, die selbst unter epistemischer Ungerechtigkeit gelitten hat, steht vor der Herausforderung, diese Muster nicht unbewusst weiterzutragen.
Warum Zwischenräume so wichtig sind
Besonders wertvoll sind Menschen, die zwischen Perspektiven stehen. Die nicht nur eine Rolle einnehmen, sondern mehrere Erfahrungswelten kennen. Laura ist eine solche Person: Physiotherapeutin und familiär selbst von ME/CFS betroffen.
Sie bringt fachliches Wissen mit und persönliche Nähe. Sie kennt die physiologischen Zusammenhänge ebenso wie die emotionale Realität eines erkrankten Angehörigen. Solche Stimmen erweitern den Raum, ohne den Schutz zu untergraben.
Sie zeigen: Differenzierung ist kein Verrat. Sie ist eine Form von Fürsorge.
Gemeinschaft braucht Atmung
Eine Community bleibt lebendig, wenn sie atmen kann. Wenn sie Schutz bietet, ohne zu erstarren. Wenn sie Halt gibt, ohne zu normieren. Wenn sie Ambivalenz zulässt, statt sie zu bekämpfen.
Das bedeutet, Räume zu schaffen, in denen Fragen erlaubt sind. In denen Zweifel nicht als Illoyalität gelten. In denen Menschen sagen dürfen: „Meine Erfahrung ist anders“, ohne Angst vor Ausschluss.
Solche Räume sind anspruchsvoll. Sie erfordern innere Stabilität, gegenseitiges Vertrauen und die Bereitschaft, Spannung auszuhalten. Doch genau darin liegt ihre Kraft.
Einladung zum gemeinsamen Weiterdenken
Gemeinschaft ist kein statischer Zustand. Sie ist ein Prozess. Und sie steht immer wieder vor der Entscheidung:
Schutz durch Kontrolle oder Schutz durch Offenheit?
Mit den Gesprächsformaten, die ich öffne, möchte ich Räume schaffen, die beides ernst nehmen: die Verletzlichkeit der Betroffenen und die Notwendigkeit von Perspektivenvielfalt. Räume, in denen Wissen geteilt werden darf, ohne verabsolutiert zu werden.
Beim Fachgespräch mit Laura entsteht genau so ein Raum: körperorientiert, praxisnah und tief verwurzelt in der Lebensrealität von ME/CFS.
Wenn du dich nach Austausch sehnst, der schützt, ohne zu begrenzen, dann melde dich an und sichere dir deinen Platz.
Denn echte Gemeinschaft zeigt sich dort, wo Sicherheit und Freiheit sich nicht ausschließen, sondern gegenseitig tragen.